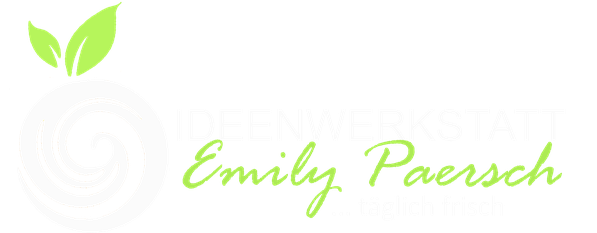Frankfurt unter Grund
Ich öffne die Augen. An mir vorbei zieht ein schwarzweißer Fries. Es lässt sich nur schwer erkennen, was diese Farbflächen darstellen sollen. Stilisierte Gläser vielleicht? Die Bahn wird langsamer bis sie stoppt. Die Türen öffnen sich. Plötzlich wird mir klar, dass ich den „Einzug in Jerusalem“ verpasst habe.
Ich hetze zur Tür und lasse mich gerade noch rechtzeitig vor dem automatischen Türschließen von der U-Bahn ausspucken. Jetzt stehe ich am „Parlamentsplatz“, einer Station der U7, und ärgere mich darüber, meine Ausstiegsstation verpasst zu haben. Normalerweise werde ich jeden Morgen von prozessionierenden Eseln in Empfang genommen, einem Maultier-Treck entlang der Wände der U-Bahn-Station „Habsburgerallee“.
Ich habe sie tatsächlich verpasst, meine morgendlichen Esel mit der ungewöhnlichen Last. Oft stehe ich verwundert vor ihnen und versuche zu verstehen, warum diese Esel nun gerade Panzer, Flaschen, Kreditkarten, Spritzen, Waschmaschinen und sonstige unübliche Eselslast transportieren. „Einzug in Jerusalem“ – so der Titel des Wandbildes. Der Frankfurter Künstler Manfred Stumpf hat diese schematische Darstellung geschaffen, ein Mosaik aus schwarzweißen Keramikplätchen. Die Darstellung ähnelt den nüchternen Piktogrammen, die uns überall begegnen. Manchmal erkenne ich mich auf sarkastische Weise in dem ein oder anderen Esel wieder – die Litanei zwischen Lust und Bürde.
Und in diesem Moment verspüre ich Bürde. Denn ich stehe nicht an der „Habsburgerallee“, sondern am „Parlamentsplatz“ und harre der U-Bahn der Gegenrichtung, die mich hoffentlich bald zu meiner Maultierkarawane bringt.
Um meine Wartezeit zu überbrücken, inspiziere ich das Wandbild gegenüber. Großflächige Emailplatten überziehen die Tunnelwand. Schematische Abbildungen von Möbeln, Haushaltsgeräten und Menschen – ein seltsames Schattentheater. Ich laufe entlang des Bahnsteigs und sehe das Kunstwerk von Udo Koch, ebenfalls ein Frankfurter Künstler, nur noch aus den Augenwinkeln.
Die Gestalten geraten in Bewegung, je schneller ich laufe. Ich renne ein Stück und erfreue mich des Taschenkino-Effektes. „Warum jetzt zurückfahren?“, denke ich, „wer weiß, was die nächste Station bietet?“ Und schon sitze ich wieder in der U-Bahn und fahre gen „Eissporthalle“. Dort erwarten mich Fotos von Gerald Domenig. In die Metallverschalung des Tunnels sind auf beiden Seiten sechs Mal zwei übereinander montierte Fotografien – gleichsam Dyptichen – eingelassen. Die Bilder zeigen Ansichten aus der Umgebung: Wohnstraßen, die Sporthalle und Momentaufnahmen der Frankfurter Dippemess (Frankfurter Volksfest, zu deutsch Topfmesse). Die eher konventionelle Art der Gestaltung enttäuscht mich ein wenig. Ein Stilleben mit Glas, Löffel und Gabel fesselt allerdings meinen Blick für eine Weile.
Ich entschließe mich, meinen Tag der Kunst unter Grund zu widmen und steuere die zwar schon oft passierte, aber noch nie genauer unter die Lupe genommene Station „Zoo“ an. „Alles so schön bunt hier“ geht mir durch den Kopf, als ich aussteige. Ich setze mich erstmal auf die nächstgelegene „Elefantenbank“ und lasse die Savannenlandschaft der Bahnsteigwand gegenüber auf mich wirken. Anderswo entdecke ich die Arche Noah. Sie hat die ganze Tierwelt in bunten Bildern ausgeschüttet. Nicht nur mir gefallen die Bilder von Hildegard Lackschewitz.
Ein kleiner Zoobesucher, gerade der U-Bahn entstiegen, steht staunend vor dem Gemälde. Mamas Hand mit der linken fest im Griff, steuert seine rechte Hand noch etwas zögerlich Richtung Nashorn. Doch dann, vergnügt quiekend, streichelt er das zweidimensionale Horn des Tieres.
Als Mutter und Sohn Richtung „wirklicher Zoo“ entschwinden, stehe ich lächelnd vor dem Nashorn und lasse es mir nicht nehmen, ebenfalls mit den Fingern über die gefährlich spitze Waffe zu streicheln. Das Quieken verkneife ich mir.
Der Mensch lebt nicht von Beton allein
Ich genieße die lustige Bilderwelt und verstehe nicht, warum man 1986, als diese Station eröffnet wurde, in Sachverständigerkreisen darüber debattieren musste, ob es sich bei den Bildern nun tatsächlich um Kunst handelt oder nicht. Während sich die Gelehrten darüber streiten, ob urbane Kunst dekorativ oder isoliert, integriert oder autonom sein sollte, bin ich glücklich, wenn die Gestaltung des öffentlichen Raums nicht nur von Ratio und Ökonomie bestimmt wird. Einfacher gesagt, freue ich mich über jedwede farbige Gestaltung des blanken Betons, mitunter auch über ansprechendes Grafitti.
Übrigens, laut Aussage eines Angestellten des Stadtbauamtes Frankfurt ist der Vandalismus der „Schmierer“ in den künstlerisch gestalteten Stationen weniger häufig zu beobachten als in den wetterfesten und abwaschbaren Betonbunkern. „Form, Licht und Farbe vermögen stimmungsbildend auf das Wohlbefinden der Benutzer einzuwirken“, heisst es in einer Broschüre der Stadt Frankfurt.
Ich hoffe nur, dass die neuerlichen Etatkürzungen der Stadt die Suche nach einer harmonischen Verbindung von Zweck und Schönheit bei der Gestaltung etwaiger neuer Stationen nicht behindert, böte doch die tägliche Fahrt zur Arbeit eine Chance zur ästhetischen Entdeckungsreise.
Wie sagte es der Heinz-Günther Prager, Universitätsprofessor und Künstler, doch einst: „Die Stadt ist Ballung, ist Vermischtes, ist Unruhe. Die Stadt ist schnell, sie pulsiert, sie vibriert in uns. Die Stadt verbindet das Außen mit dem Innen. Die Stadt ist ein überquellendes, künstliches Organ, sie verwandelt alles in Bilder.“